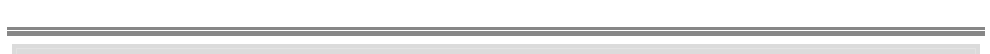[Bei ihrem ersten Ãķffentlichen Fernsehauftritt zu dem Thema âTrennbankensystemâ am 18. Oktober bewiesen die beiden Autoren der Initiativen fÞr Bankentrennung im Schweizer Parlament, der Sozialdemokrat Corrado Pardini (SP) und Christoph Blocher von der Schweizerischen Volkspartei (SVP), daà ihre von der Bankenlobby als âunheilige Allianzâ geschmÃĪhte Zusammenarbeit nicht wankt. Anders als die Neue ZÞrcher Zeitung (NZZ) und andere in einem Psychokrieg behaupten, machen beide keine Abstriche an ihrem Ziel einer strikten Bankentrennung wie in den USA unter Glass-Steagall.
Gegenargumente in der Fernsehdiskussion kamen von der PrÃĪsidentin der Fraktion der liberalen FDP in der Bundesversammlung, Gabi Huber, und von StÃĪnderatsmitglied Pirmin Bischof von der christdemokratischen CVP, aber Blocher und Pardini wichen von ihren beiden getrennten, doch praktisch identischen Gesetzesvorlagen nicht ab. Sie fordern eine âgrundsÃĪtzliche Trennung der VermÃķgensverwaltungs- und GeschÃĪftsbanken einerseits von den Banken mit Eigenhandel andererseitsâ. Beide zeigten sich auch zuversichtlich, daà sie sich im einzigen bisher unterschiedlichen Punkt, der vorgeschriebenen Eigenkapitalquote der Banken, noch einigen werden.
Pardini sagte, die Schweiz brauche Banken, aber Banken, die der Gemeinschaft nÞtzen, indem sie Kredite vergeben, Hypotheken finanzieren, Einlagen und VermÃķgen verwalten. Solche Banken sollten von Banken, die FinanzgeschÃĪfte betreiben, getrennt sein. Sie sollten staatlich geschÞtzt werden, letztere aber nicht, dann sei die Gemeinschaft nicht gefÃĪhrdet, wenn solche Banken scheitern.
Blocher vertrat dieselbe Linie, betonte aber auch, man solle die âAmerikanisierungâ des Schweizer Bankwesens beenden, womit er die enorme Zunahme der (spekulativen) FinanzgeschÃĪfte der beiden GroÃbanken UBS und Credit Suisse (CS) meinte. WÃĪhrend die anderen Politiker die âStabilitÃĪtâ von UBS und CS lobten, setzten beide dagegen, diese GroÃbanken seien alles andere als sicher. TatsÃĪchlich gebe es kein anderes Land der Welt, in dem zwei Banken allein Þber fÞnfmal mehr VermÃķgenswerte verfÞgen als das gesamte nationale Wirtschaftsprodukt. Dieses Systemrisiko mÞsse ausgeschaltet werden.
Vor der Debatte hatte Gian Trepp, ein Mitglied des SP-Ausschusses, der das BÞndnis mit der SVP aushandelte, die Argumente des PrÃĪsidenten des Verbands der Schweizerischen Kantonalbanken Urs MÞller widerlegt. MÞller hatte sich in der NZZ fÞr mehr Regulierung der international aktiven GroÃbanken, aber weniger strenge Vorschriften fÞr Kantonalbanken eingesetzt. Dies sei falsch, schrieb Trepp in seinem Blog, da dann aus den Kantonalbanken Spekulationsbanken werden kÃķnnten. MÞller nenne dies âgutschweizerische, liberale Regulierungâ, so Trepp, aber die âliberaleâ Revolution von 1848 sei nur ein Element der Schweizerischen nationalen IdentitÃĪt, zwei andere Daten seien ebenso wichtig: 1291 und 1918. âDer Dreiklang 1291-1848-1918 legt die Basis zur Definition des Begriffes ,wirtschaftliches Landesinteresseâ im 21. Jahrhundert und damit auch die Basis der dringend nÃķtigen Reform des Schweizer Bankensystems.â
Zur Erinnerung: 1291 wurde die Schweizer Nation geboren, als drei Kantone sich zu einem Bund zusammenschlossen und die Freiheiten, die Kaiser Friedrich II. ihnen gewÃĪhrt und der Habsburger-KÃķnig ihnen wieder genommen hatte, zurÞckgewannen. Der Bundesbrief von 1291, der die Grundlage eines Verfassungsstaats enthÃĪlt, gilt heute zusammen mit dem spÃĪteren RÞtlischwur und der von Friedrich Schiller gefeierten Tell-Legende als Ausdruck der GrÞndungsprinzipien der Schweizer Nation. Daà sich drei Kantone, die einander vorher blutig bekÃĪmpft hatten, in dieser Weise verbÞndeten, war auf begrenzterer Ebene eine Vorwegnahme der Idee des WestfÃĪlischen Friedens (1648). Sie erkannten, daà eine LÃķsung nur mÃķglich ist, wenn aus ehemaligen Feinden Partner werden.
1918 wurde gegen Ende des Ersten Weltkriegs, nachdem eine verheerende Grippeepidemie die BevÃķlkerung dezimiert hatte, in der Schweiz ein Generalstreik ausgerufen. Obwohl er letztlich unterdrÞckt wurde, zwang er die Regierung zu ZugestÃĪndnissen bei den BÞrger- und Arbeitnehmerrechten, wie einem allgemeinen Wahlrecht, EinfÞhrung der 48-Stunden-Woche und Tarifrechte der Gewerkschaften.
Videos zum Thema
Aktuelles zum Thema
Artikel
EMPFEHLUNGEN
Min
Artikel von Zepp-LaRouche
Artikel von Zepp-LaRouche